„Was weißt du eigentlich über den Konflikt?“ fragt mich Safae. Sie gibt zusammen mit Abiya den Kurs mit Arabern und Juden, wegen dem ich ursprünglich hierher gekommen bin und hat mich zu einem Treffen eingeladen, um sicher zu gehen, dass ich weiß, in was ich mich da reinstürze.
Was ich weiß über den Konflikt? Ich stutze und bin erstmal überfordert. Wie antworte ich auf solch eine Frage? Sie ist Muslimin und ich will ihr zeigen, dass ich nicht „zu den Juden gehöre“, aber Fakt ist, dass ich bisher 99 % meiner Zeit mit nicht-religiösen oder jüdischen Israelis verbracht habe und die Perspektive der Araber, die in Israel leben, kaum kenne. Ja, natürlich habe ich mich über die Besetzung der palästinensichen Gebiete informiert (https://972mag.com/ , https://www.youtube.com/watch?v=7ayiO1Gl6lo ) aber auch hier ist das hauptsächlich Information von linkspolitischen Juden. Den realen Kontakt zu Arabern in Israel hatte ich nicht, außer Fawzi, einem palästinensischen 23-jährigen Schuhverkäufer aus Bethlehem. Ich weiß noch ganz genau, wie aufgeregt ich war, endlich „die andere Seite“ kennen zu lernen. Er hat mich und Amina für eine Nacht aufgenommen und uns durch die Stadt gefahren, uns die „wichtigen“ Orte gezeigt. Erst die Friedenstaube von Banksys, dann eine Kirche in der Wüste (Fawzi spricht von dem friedlichen Miteinander von Christen und Muslimen), die 500 km lange Mauer, die zwei Welten voneinander trennt, die Altstadt mit den Obstverkäufern auf den Straßen und zu guter Letzt ein wunderschönes Restaurant, abseits gelegen, mit Blick auf die Berge. Da mich meine Neugierde wie ein quängelndes Kind immer wieder in die Seite piekst, habe ich meine typischen Fragen gestellt: „Was macht ihr so während einer Intifada?“ – „Aus Spaß gehe ich manchmal für 5 Minuten raus mit einer Dose und spray irgendwas; den Rest der Zeit warten wir ab und schauen die Nachrichten. Und ja dieser Ort hier fühlt sich an wie ein halbes Gefängnis. Die Präsens der Mauer ist immer zu spüren. Aber hey. Ich bin hier als ein Freund.“ Mit seinem letzten Satz hat er mich gebremst. Ich hab ein paar Sekunden gebraucht um ihn zu verstehen. Er ist nicht mein Interview-Partner. Sondern möchte mir als Mensch begegnen.

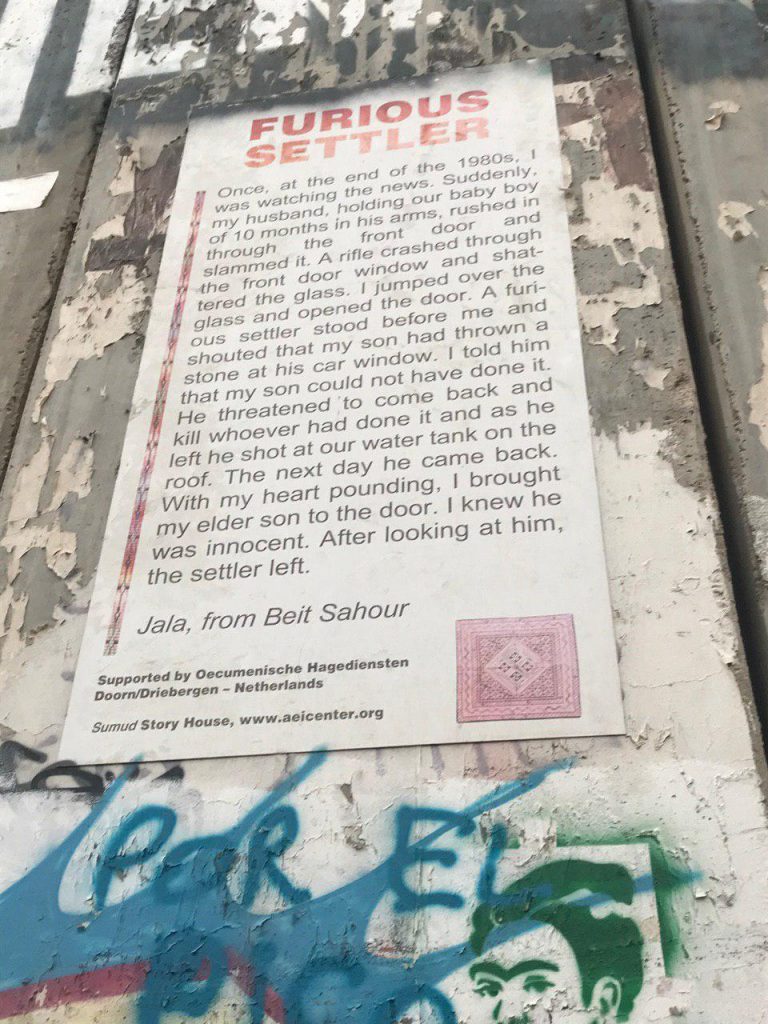
Genauso kompliziert wie der Konflikt selber, ist es, zu erklären, was ich darüber weiß. Denn jede Antwort die ich gebe, macht nur Sinn, wenn ich sie relativiere mit all den anderen Informationen, die ich habe. Denn scheinbar kann keine Antwort für sich alleine stehen, ohne jemanden damit anzugreifen. Ich erinnere mich gut, wie es war, mit dem Bus von Bethlehem nach Jerusalem am Grenz-Checkpoint zu stehen, und auf die wenigen Palästinenser zu warten, die aus dem Bus geklettert sind um ihre Arbeitsvisen vorzuzeigen um in das ihnen sonst verbotene israelische Gebiet zu gelangen, während Juden und Touristen gemütlich im Bus sitzen blieben. Doch genauso haben mich die Geschichten derer berührt, dessen Vorfahren im Holokaust umgekommen sind und dessen Eltern in Israel Schutz gesucht haben. Sobald ich nur eine Geschichte erzähle, scheint es, als nähme ich Position ein.
Doch was weiß ich konkret, Fakten-technisch? Die folgenden groben Daten bilden einen kleinen Überblick:
- Seit ca. 1870 : Hauptsächlich Ashkenazi (Osteuropäische Juden) in kleinen Wellen ins „Heilige Land“ und bilden Siedlungen in den Gebieten von Zfad, Tiberias, Jerusalem und Hebron
- 1945 – Ende des 2. Weltkrieges
- 1948 – Das Jahr, in dem die UN für das Bestehen des Israelischen Staat stimmt (Israelische Unabhängigkeit) – Juden aus aller Welt kommen und unterstützen die zionistische Bewegung, etliche Palästinenser werden aus ihrer Heimat vertrieben
- 1967 – 6 tägiger Krieg – Annektieren von West Bank, Gaza, Golan Hights und Sinai (heutiges Ägypten)
Alon (President der sogenannten linken Arbeiterpartei) – Plan wird umgesetzt: strategisches Umranden der palästinensischen Gebiete durch Siedlungen und Trainingsplätze des Militärs - 1973 – Yom Kippur Krieg – nach dem Angriff von Ägypten und Syrien wird Sinai an Ägypten zurückgegeben
- 1979 – Friedensvertrag mit Ägypten “Camp Davi” + PLO (Palestinian Liberation Organization) wird legitimiert in der West Bank
- 1997 – Oslo Protokol: die Westbank wird in 3 Zonen (A,B,C) geteilt, wobei in den dicht befölkerten Zonen A und B das Israelische Militär unter Kontrolle ist und buchstäblich machen kann, was es möchte
- 2000 – 2005 2. Intifada: Bau der Mauer, die die Westbank von den Israelsichen Gebieten trennt, Grenze zu Gaza wird geschlossen
Soll ich ihr also all das sagen? Wie kann ich ihr beweisen, dass ich nicht blind in diesen Kurs hineingehe? Dass ich mir bewusst bin über die Komplexität und die vielen Facetten und die hohe Emotionalität, die das Thema mit sich bringt? Und wie mache ich deutlich, dass meine Neugierde einfach überwiegt? Dass ich einen tiefen Wille spüre, diesen Konflikt und die Menschen, die einen Teil davon bilden zu verstehen und dass ich dabei sein will, wenn es um den Versuch geht, Musik zu nutzen, um sich einander anzunähern… ?
Mein Körper wird heiß, ich spüre Schweißperlen auf meiner Stirn, meine Stimme klingt eng und mir steigen Tränen in die Augen. Ich glaube, sie erkennt, wie wichtig es mir ist…





