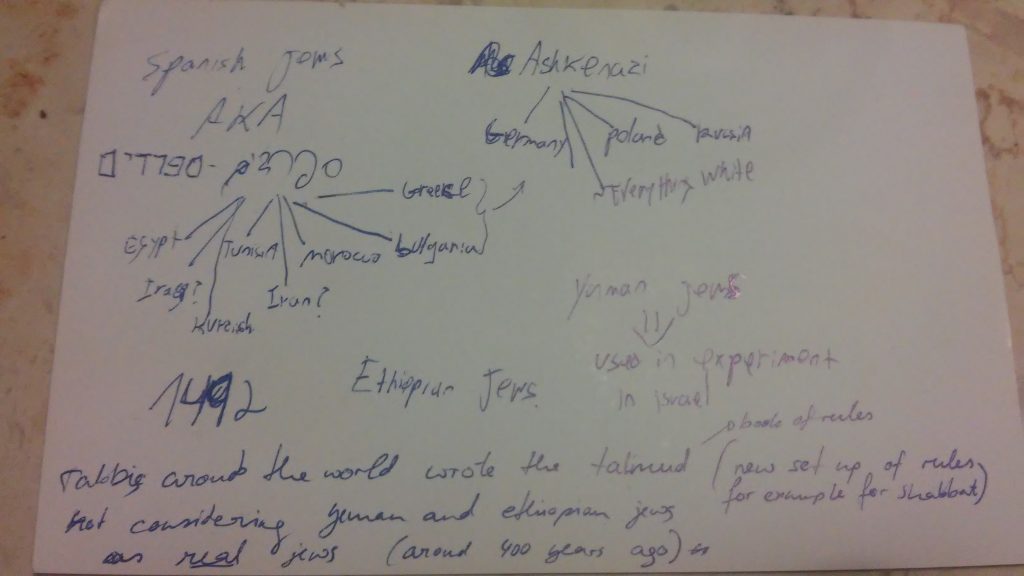Das Radio läuft. Wir räumen den Frühstückstisch ab und Tadita meint, sie würde gerne mit mir reden. „Es herrscht Spannung.“ Kurz brauche ich um zu verstehen, dass es nicht um die Familie geht, sondern um die Gegend in der wir wohnen. „Wie meinst du das?“ Der israelsiche Geheimdienst hat einen Angriff von iranischen Millizen erkannt und diese gestern ihren Militärstützpunkt in Syrien attakiert. Anscheinend waren sie kurz davor gewesen, Israel anzugreifen. Das wurde verhindert. Erstes Gefühl: Erleichterung. Heißt das, ich freue mich gerade darüber, dass wir zuerst angegriffen haben? Wir… also diejenigen, die meinen jetzigen Wohnort verteidigen…. Der Ort, zu dem ich für diesen Moment gehöre, egal was meine eigene Geschichte ist… ? Ich kann es nicht leugnen, für diesen Moment bin ich erleichtert, dass es nicht vor meiner eigenen Haustüre eskaliert ist.
Nehme ich jetzt Position ein?
Wir wohnen sehr nah an dem allzeit umkämpften Gebiet, den Golan Höhen, nah zur syrischen und libanesischen Grenze. Es sind keine Nachrichten von der anderen Seite der Welt. Es spielt sich jetzt und hier ab.
Letztens wurde mir von den israelischen bewohnern erzählt, die an der libanesischen Grenze am Berg wohnen und nachts immer ein Klopfen hören. Anscheinend werden Tunnel gegraben und es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie es schaffen ihren Weg durch den Berg zu machen. In den Nachrichten hieß es, dass gestern ein Angriff von Seiten des Libanon durch Schwebeflieger geplant war. Doch auch hier war Israel schneller.
Iran unterstützt im Libanon die Hizballah (Wikipedias Erläuterung – sicher nicht genügend nuanciert: „a Shia Islamist political party and militant group based in Lebanon”, „The group, along with its military wing is considered a terrorist organization by …“, „Hezbollah was conceived by Muslim clerics and funded by Iran primarily to harass Israel.”). Sie nehmen mittlerweile 40 % der Sitze in der Regierung ein und Tadita erzählt sehr traurig davon, weil sie das Land Libanon sonst als so wunderschön erfährt. Soweit sie das einschätzen kann, denn sie darf selber als Jüdin nicht dorthin reisen. Die Hizballah nisten sich anscheinend in den Häusern von Bewohnern in kleinen Dörfern ein um sich so vor israelischen Angriffen zu schützen. Sie wissen, dass Israel und Libanon nicht befeindet sind. Manchmal zerstört Israel dann die Häuser von den Bewohnern, in denen sie denken, dass Terroristen wohnen und natürlich sind die Libanesen empört. Dann klingt es nach: Israel greift Libanon an oder Libanon greift Israel an. Wobei es überhaupt nicht um die Menschen selber geht, die da wohnen.
Ähnlich geht es zu im Gaza Streifen, sichtbar ist nur das Regime Hamaz und nicht all die anderen Leute, die dort wohnen; anscheinend in extrem armen Zuständen, weil all das Geld, dass von Hilfsorganisationen kommt, nicht an sie weiter gegeben wird. Gerade sei die Hamaz anscheinend zum ersten Mal bereit einen Vertrag mit Israel abzuschließen. Doch jetzt hat sich eine extrem radikale Gruppe von der Organisazion abgekoppelt, die auf eigene Faust auf israelisches Gebiet gelangen wollen. So schnell der Hoffnungsschimmer aufleuchtet, verweht er wieder.
In meinem Versuch, die Situation zu verstehen, beginne ich zu generalisieren. „Die Araber fördern diesen Konflikt und sind nicht bereit für Frieden.“ Nein, ziehmlich daneben. Die Iraner sind ja keine Araber. „Die Muslime sind nicht bereit mit Israel Frieden zu schließen.“ Nein, auch nicht. Nach Ägypten und Jordanien dürfen Israelis einreisen und das machen sie auch mit großem Vergnügen seit dem Friedensvertrag, in dem Sinai an Ägypten zurückgegeben wurde. Und sowieso leben in Israel lauter muslimische Palästinenser. Und was ist mit all den Muslimen aus dem Libanon, die aus ihren Häusern vertrieben wurden durch die Hizballah? Und wieso kämpfen Hamaz und IS dann nicht gemeinsam, wenn es doch um den heiligen Ort in Jerusalem geht? Also ist „es geht um Religion“ wohl auch keine stimmige Schlussfolgerung. Wie ich es drehe und wende, meine Erklärungen sind zu einfach und münden nach kurzer Reflexion in einer Sackgasse.
Woher bekommen die Staaten überhaupt ihr Geld und ihre Waffen um all diese Kriege überhaupt auszuführen? Spätestens hier kann gar nicht mehr ausgeschlossen werden, dass Europöische Staaten und alle anderen einflussreichen „Großmächte“ auch mit im Spiel sind. Sind wir deutsche Steuerzahler für den Mist verantwortlich? Wir sind nun mal auf unsere Exporte angewiesen um unseren Wohlstand zu wahren…
Also wenn alle irgendwie eine Rolle spielen, bleibt als einzige Konklusion, dass wir Menschen im allgemeinen einfach nicht in Frieden leben können. Wollen. Wissen…?
Wobei man ja meinen könnte, wir sehnen uns alle danach. Wer hat also so viel Spaß daran, dass das weiterhin möglich ist während ich hier sitze, Basilikumblätter für Pesto zupfe und mir anhöre, wie wir von allen Seiten attakiert werden. Ich muss mir ja eigentlich auch keine Sorgen machen, denn das israelische Sicherheitssystem hat eh alles unter Kontrolle. Es erkennt Raketen in der Luft und fängt sie ab oder entschärft sie. Es ist so stark entwickelt, dass es weltweit dafür anerkannt wird und die neusten Technologien verkauft. Diese müssen entworfen und dann auch getestet werden. Naja, und ohne Krieg ist das schwierig…
„It’s really complicated.“ Das ist ein Satz, den ich hier schon zig male gehört habe. Auch wenn ich das davor schon wusste, jetzt fühle ich es. Es ist einfach nicht geil, wenn der eigene Wohnort angegriffen wird. Wobei es mir glaube ich weniger um Angst geht, also um Trauer über die Auswegslosigkeit des Konfliktes. Ich habe viele Freunde aus dem Iran. Und ich liebe es in München beim Libanesen Falafel zu essen. Ich will nicht, dass zurück gekämpft wird. Aber ich will um ehrlich zu sein auch nicht, dass jemand Bomben hierher schickt und zum Beispiel dieses Haus kaputt macht, wo die Familie in den letzten 40 Jahren aus einer Steppe eine grüne Oase gezaubert hat.