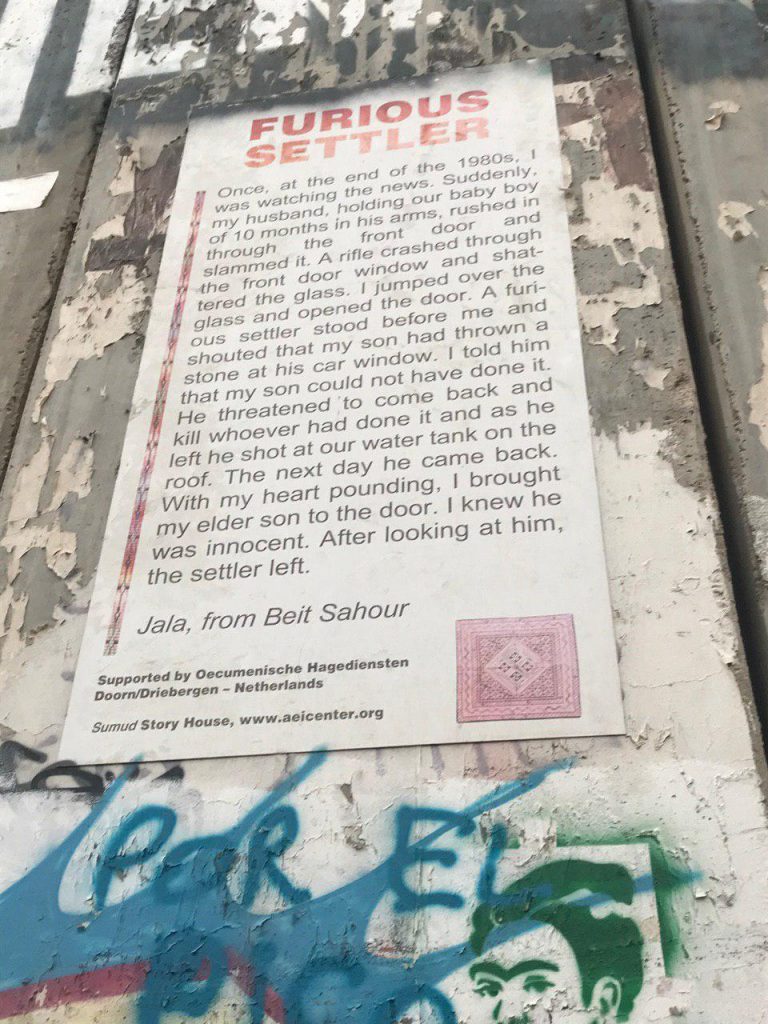Gerade habe ich ein Video von Christine and the Queens gesehen.
(https://www.youtube.com/watch?v=-23e7qJ_4wY&feature=youtu.be)
Ihr Worte haben für mich den Kern des Themas „Identität“ beschrieben. „ I’m using theater to be actually really exposed. […] I’m exploring identity as a construction. […] I’m going to chose my narrative. […]” Sich als Chris auf der Bühne zu presentieren ist für Hélöise Letissier eine Möglichkeit, in einer spielerischen und distanzierten Form ihren versteckten/ schlummernden Qualitäten und Fantasien eigen Raum zu geben und sich zu entfalten. Und das Spannende ist, dass sie sich nach einiger Zeit mit diesen Eigenschaften auch in ihrem echten Leben identifizieren kann.
Etwas ähnliches passiert mir, wenn ich mich in einem anderen Land einlebe. Ortswechsel und die Begegnung mit anderen Charakteren und Lebensweisen geben mir die Chance, Resonanz zu finden für die Teile in mir, die zuvor nicht genährt wurden. Mit rosa Kleid, langsam und behutsam durch den Garten zu laufen würde in meinem normalem Alltag meiner wuseligen und burschikosen Art widersprechen. Deswegen fällt es mir auch so schwer, jemanden aus meinem „alten“ Leben einzuladen, mein „neues“ Leben kennenzulernen. Denn ich stehe konstant vor der Frage, welchem „Ich“ ich nun mehr Raum gebe. Auch wenn ich mich mit meinen neu entdeckten Eigenschaften angefreundet habe, sind sie noch kein Teil der Freundschaft mit der alt bekannten Person. Und wer weiß, ob sie/er mich dann noch akzeptiert?
Wenn ich ein anderes Land wirklich erleben möchte, dann ist mein Ansatz vorallem mitzuströmen. Wie ein Kind, dass nicht weiß, wie man mit Geld umgeht und einkauft, wie man dem Crush begegnet und welche Normen und Werte gesellschaftlich akzeptiert sind. Ich habe die Chance, alles von Neuem zu lernen. Nur dieses Mal bin ich älter und kann mich entscheiden, ob ich mich diesen neu erlernten Standarts anschließen möchte oder nicht. Mir wird die Möglichkeit gegeben, unerfahren und naiv auf Dinge zu blicken, doch gleichzeitig kann ich mich darauf verlassen, dass ich meine Erfahrungen mit mir trage und nicht alles blind aufnehmen muss. Ich muss meine Beine nicht rasieren, auch wenn das hier alle anderen sonst schon machen. Als Kind sind wir diesem Standart ausgeliefert, denn er ist der Einzige, den wir kennen. Wenn wir ihm nicht gerecht werden, sind wir erstmal komisch und irgendwie fehl am Platz. Ich denke, dass ich hier nicht nur von Kindern spreche, sondern von allen Menschen, die nicht die Chance hatten, diese Standart zu hinterfragen und eine Alternative zu dem ihnen Bekannten kennenzulernen.
Als etwas reiferes Kind habe ich jetzt die Chance, mich zu entscheiden. Ich kann mich etscheiden, wo ich gerade ein Schwamm sein will, der alles aufsaugt und mitfließt mit dem Vibe um mich herum und wo ich mich darauf verlassen möchte, dass ich weiß, wie die Dinge laufen und wer ich bin… Ich kann hin und her switchen zwischen Bekanntem und Unbekanntem, zwischen Sicherheit und Unsicherheit, zwischen Kontrolle und Flow, zwischen Lernen und Leren, zwischen Aufregung und Ruhe.
Wenn ich also weit weg bin und mich keiner kennt, dann muss ich dieses Experiment (das ausprobieren anderer Charaktäre) nur vor mir selber rechtfertigen. Doch erlaube ich mir das? Licht auf meine unerforschten Eigenschaften und Seiten, Wünsche und Fantasien zu werfen? Im ersten Moment fühlt sich das fremd an und tatsächlich falsch. Es passt nicht in das Bild, das ich jeden Morgen im Spiegel sehe und das ich mehr oder weniger bewusst versuche, aufrecht zu erhalten. Ist es das, was wir Authenzität nennen? Das Festhalten an einer einzigen Person? Oder steht Authenzität mehr für das Folgen eines Impulses im Moment, auch wenn dieser Impuls unserem Spiegelbid widerspricht?
Was bedeutet es eigentlich, für einen (kurzen oder langen) Moment die Person loszulassen, die wir meinen zu sein? Was bedeutet es, sich der eigenen Unwissenheit zu stellen und die anderen um Erklärung und Hilfe zu fragen? Wer bin ich dann, wenn ich all das Wissen, dass ich über die Jahre gesammelt habe, erstmal über Bord werfe? Wer bin ich, wenn ich mich von meinem depressiven Charakter verabschiede? Wenn ich jahrelang so gelebt habe, woher soll ich dann wissen, wie jemand lebt, der glücklich ist? Wie fülle ich die Leere als Mutter und Hausfrau, wenn meine Kinder ausziehen? Und wenn ich all mein Leben nach dem Erfolg in meinem Beruf gerichtet habe, wer bin ich dann in der Pension? Wer bin ich außerhalb dieser Funktion, die zu meinem Lebensinhalt geworden ist?
מה זה נשאר?
Was bleibt?
Es scheint mir, dass wir unserer Identität die Zweige abscheinden und den Baum vorallem in die Höhe wachsen sehen wollen. Der Stamm wird viele Wunden tragen und wenig Schatten spenden, doch schon von Weitem sichtbar sein und Platz für viele andere gleichaussehende Bäume schaffen.
Es passt für mich zu unserem linearen Denken (dazu ein Artikel: https://charleseisenstein.org/essays/climate-change-the-bigger-picture/) und der Frage, warum wir etwas tun oder warum wir jemanden lieben..
Ja, warum überhaupt Israel, was hat das denn mit meinem Studium zu tun? Und warum stecke ich so viel Zeit und Energie ist das Lernen einer Sprache, die vielleicht 9 Millionen Menschen auf dieser Welt sprechen? Ich habe nicht vor mich hier einzubürgern und genauso wenig bin ich jüdisch…
Wieder einmal kommt die Motivation von tiefer her. Vielleicht von der Neugierde heraus, die Menschen hier in ihrer Routine kennenzulernen und meinen Blick zu erweitern. Was ich dabei lernen werde und wie mich das als Person weiterbringt? Keine Ahnung. Und genau dieses Zugeständnis, keine Ahnung zu haben, das macht mir manchmal Angst. Es bringt mich in eine Position von Ratlosigkeit und Abhängigkeit. Kontrolllosigkeit. Aber es öffnet auch Türen zum Verständnis der Komplexität dieser Welt und der Erkenntnis, dass alles andauernd fließt und im Wandel ist. Und meine momentane Ahnung im nächsten Moment ihre Bedeutung verliert, oder gar umschwingt und sich das Gegenteil offenlegt.
Ich denke an eine Chinesische Parabel, die mir mein Papa vor Jahren geschenkt hat und die mich seit dem begleitet:
Der chinesiche Bauer
Vor dreitausend Jahren herrschte in China ein grausamer und selbstsüchtiger Kaiser. Zum Schutz seines riesigen Reiches ließ er eine 6000 Kilometer lange Mauer errichten. Bei dem geforderten Frondienst kamen viele seiner Untertanen ums Leben.
Zu jener Zeit lebte in China ein alter Bauer, der in der einfachen Welt, die er liebte, nur zwei Dinge sein eigen nannte: seinen einzigen Sohn und sein Pferd. Eines Tages lief ihm das Pferd davon, und so war der Bauer noch ärmer als zuvor. Nachdem die Nachbarn davon gehört hatten, kamen sie herbei, um ihn zu trösten: Was für ein Unglück, dass dein Pferd weggelaufen ist!
Der alte Mann aber fragte: Woher wollt ihr wissen, dass dies ein Unglück ist?
Einige Tage darauf kehrte das Pferd zurück, gefolgt von sechs anderen wilden Pferden, die der Bauer zähmte und in seinen Dienst nahm. Auf diese Weise wurde der Wohlstand des alten Mannes gesteigert. Die Dorfbewohner bemerkten dies und kamen zu ihm und lobten: Was für ein Glück du hast mit deinen sieben Pferden!
Der Bauer aber sann eine Weile nach und antwortete: Wie wollt ihr wissen, dass es ein Glück ist?
Am gleichen Nachmittag beschloss der einzige Sohn des alten Bauern, auf einem der wilden Pferde auszureiten. Er wurde jedoch aus dem Sattel geworfen und verletzte sich schwer, so dass er seine Beine nicht mehr brauchen konnte. Da kamen Verwandte und Bekannte und sprachen: Was für ein Unglück, dass dein einziger Sohn nun ein Krüppel geworden ist!
Der alte Chinese aber gab zurück: Wieso könnt ihr wissen, dass dies ein Unglück ist?
Am folgenden Tag kamen die Abgesandten des Kaisers in das Dorf und befahlen, dass alle gesunden jungen Männer sich zum Bau der großen Mauer melden müßten. So wurde jeder junge Mann aus der Gegend zur Zwangsarbeit verpflichtet, nur der Sohn des alten Bauern durfte zu Hause bleiben. Da kamen die Ältesten der Stadt zu ihm und priesen ihn: Was für ein Glück du nur hast, dass dein Sohn nicht für den Mauerbau eingezogen wurde!
Doch der Bauer sah sie an und meinte: Was gibt euch die Sicherheit, dass dies ein Glück ist?
Nun wurden die Stadtväter nachdenklich und fingen an, sich zu beraten. Nach einem Tag kehrten sie zum alten Bauern zurück und teilten ihm mit: Wir haben eingesehen, dass du der weiseste Mann in ganz China bist. Wir würden es deshalb als grosses Glück ansehen, wenn du unser Gemeindevorsteher würdest.
Ein letztes Mal fragte der alte Mann: Woher wollt ihr wissen, dass dies ein grosses Glück wäre?
Mit diesen Worten lehnte er das hohe Amt ab, denn er kannte das Geheimnis des Glücks!
(Aus Beat Imhof: Wahrheit & Weisheit, S. 84, Rothus Verlag, Solothurn 1995)